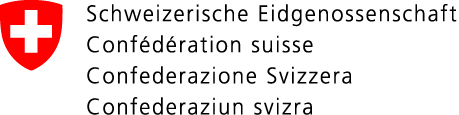Herr Rösti, Sie machen der Autolobby mit ihrer neuen CO2-Verordnung ein Geschenk. Sie erfüllen darin eine Forderung von Auto Schweiz – dem Verband also, den Sie bis vor zweieinhalb Jahren präsidiert haben. Für wen machen Sie Politik: Für die Autolobby oder für die Bevölkerung?
Wenn ich Politik für Auto Schweiz machen würde, hätte ich ganz andere Massnahmen getroffen. Der Bundesrat hat diese Verordnung sogar rückwirkend in Kraft gesetzt, per Anfang dieses Jahres. Das heisst, die Bedingungen zur CO2-Reduktion müssen sofort eingehalten werden. Die Branche war klar dagegen. Aber wir haben den Autohändlern mehr Flexibilität gewährt, weil der Markt für Elektroautos schleppender verläuft als erwartet. Bis 2030 müssen sie aber die Ziele erreichen.
Alle Autohändler, die ein Viertel Elektroautos verkaufen, dürfen künftig Verbrenner kaufen, die besonders viel Benzin brauchen. Und die Anreize, mehr E-Autos zu verkaufen, nehmen ab.
Das Hauptproblem war , dass bis vor kurzem Elektroautos teurer waren als Verbrennerautos. Die Händler müssen sowieso zusätzliche Anstrengungen betreiben, damit mehr Elektroautos gekauft werden. Sonst werden sie sanktioniert. Es macht aber keinen Sinn, wenn hunderte von Millionen Franken an Sanktionen anfallen. Diese Rechnung bezahlen letztlich nicht die Autoimporteure, sondern die Konsumierenden mit höheren Preisen.
Hat es nicht einen schalen Beigeschmack, dass Sie Ihrem ehemaligen Verband entgegenkommen?
Die Elektrifizierung des Verkehrs braucht etwas länger, als man erwartet hat. Wir haben lediglich ein kleines Zeichen gesetzt, um den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Händler zu begegnen, ohne weiter zu gehen als die EU, die auch Erleichterungen festlegt.
Alle Unternehmen, die sich zur Reduktion von Treibhausgasen verpflichten, sollen künftig von der CO2-Abgabe befreit werden. Auch ihnen sind Sie entgegengekommen: Sie haben das Reduktionsziel tiefer angesetzt, als geplant. Weshalb?
Bisher hatten wir gar kein fixes Mindestziel für die Reduktion der Emissionen. Es stimmt, wir sind den Unternehmen leicht entgegengekommen. Sie hatten allerdings gefordert, dass das Mindestziel ganz gestrichen wird. Theoretisch könnten wir das CO2-Ziel bis 2050 sogar erreichen, wenn Firmen ihren CO2-Ausstoss um nur 2 Prozent pro Jahr reduzieren würden. Wir haben die Vorgabe nun bei 2,25 Prozent angesetzt, weil wir finden, wer von der CO₂-Abgabe befreit ist, soll etwas mehr leisten, als der Durchschnitt.
Schafft die Schweiz es trotz diesem doppelten Entgegenkommen für Firmen, den CO2-Ausstoß wie geplant zu reduzieren?
Ich bin zuversichtlich. Ich denke, wir schaffen es, bis 2030 alle Ziele zu erreichen und die Emissionen im Inland um rund einen Drittel gegenüber 1990 zu reduzieren, wie es das Parlament verlangt.
Und wie sieht es mit dem Ziel aus, bis 2050 Netto-Null Treibhausgasemissionen zu erreichen?
Stand heute ist klar: Wir wollen die Dekarbonisierung. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht die Augen davor verschliessen, dass unsere Wirtschaft zu 50 Prozent von Exporten abhängig und die Wettbewerbsfähigkeit zentral ist. Daher möchte ich auf Innovation setzen statt auf höhere Energiepreise. Die Frage ist, ob es uns gelingt, mit Innovation alleine die Ziele zu erreichen.
Die USA haben sich aus dem Klimaabkommen zurückgezogen. Sollte die Schweiz Ihre Anstrengungen trotzdem fortführen?
Ja, wenn der Bundesrat 2030 das neue Gesetz für die CO₂-Reduktion bis 2040 formuliert, muss er aber auch die internationale Entwicklung beachten.
Ihre Partei will das Pariser Klimaabkommen kündigen. Und Sie scheinen nun zu sagen: Schauen wir mal, ob wir die Ziele dann erfüllen können?
Nein, die Bevölkerung hat gesagt, die Schweiz muss bis 2050 netto null erreichen. Daran halte ich mich.
Ihnen wurde von linker Seite schon mehrmals vorgeworfen, sie würden via Verordnungen Politik machen. Nun tun Sie es wieder.
Mit der CO2-Verordnung setzen wir Parlamentsentscheide um, die beim CO2-Gesetz getroffen wurden. Wir machen Vernehmlassungen nicht zum Spass. Ich muss Kritik aufnehmen, damit tue ich nichts als meine Pflicht. Aber selbstverständlich macht der Bundesrat Politik. Und natürlich will auch ich Politik machen und gestalten. Aber es bewegt sich alles innerhalb des gesetzlichen Spielraums.
Sind Sie auch Kritikern von links entgegengekommen?
Nein. Aber die meisten Akteure von links hatten unsere Vorschläge im Grossen und Ganzen positiv beurteilt. Sie wollten bloss weiter gehen. Nur Akteure aus der Wirtschaft haben die Vorschläge ganz abgelehnt.
Der Bundesrat hat am Mittwoch auch entschieden, dass er künftig gewisse Gentech-Methoden erlauben will. Bisher hielt das Parlament strikt am Moratorium fest. Weshalb finden Sie es richtig, die Regeln zu lockern?
Das Parlament hat uns diesen Auftrag erteilt. Und ich bin überzeugt, dass dies richtig ist. Die neuen Methoden unterscheiden sich grundlegend von der herkömmlichen Gentechnik. Es gibt weniger Risiken. Die Schweiz muss die Chance dieser neuen Verfahren nutzen, aber auch die Vorbehalte der Bevölkerung berücksichtigen. Deshalb soll es Risikobewertungen und Kontrollen geben.
Warum braucht man dafür ein eigenes Gesetz? Um die Tatsache zu verschleiern, dass es sich um Gentechnik handelt?
Wir verbergen nichts. Da es sich aber um sehr unterschiedliche Methoden handelt, ist es normal, dass es ein neues Gesetz gibt.
Das Bundesamt für Justiz sah das anders.
Natürlich war es auch eine politische Entscheidung. Das Ziel des Bundesrats ist es, zu zeigen, dass wir nicht von denselben Methoden sprechen. In der herkömmlichen Gentechnologie wird DNA verschiedener Arten gemischt. Der Anbau von Pflanzen aus solchen Gentechnologien bleibt auch künftig verboten. Bei den neuen Züchtungsmethoden fügt man hingegen DNA derselben Art hinzu. Diese Technologie ist revolutionär. Übrigens sieht die EU auch ein Spezialgesetz wie wir vor.
Mit diesen neuen Methoden wird es nicht mehr möglich sein, zwischen gentechnisch veränderten und natürlichen Arten zu unterscheiden. Ist das nicht riskant?
Genau aus diesem Grund planen wir eine Risikobeurteilung. Im Gegensatz zur EU wollen wir, dass jede neue Sorte oder jedes Saatgut, das mit diesen neuen Methoden hergestellt wird, zuerst geprüft wird. Überdies sollen die Warenflüsse kontrolliert werden. Und wenn Produkte aus Pflanzen hergestellt werden, die mit neuen Methoden gezüchtet werden, müssen diese gekennzeichnet werden…
…allerdings mit dem Vermerk „aus neuen Züchtungstechnologien“. Wie viele Migros- und Coop-Kunden wissen, dass es sich dabei um genetisch veränderte Lebensmittel handelt?
Heute keiner, weil es diese Bezeichnung noch nicht gibt. Aber in zwei Jahren, wenn wir über dieses Thema diskutiert und wahrscheinlich eine Volksabstimmung durchgeführt haben, wird es ganz anders aussehen. Die Konsumenten sind sehr reif. Vor 40 Jahren wusste niemand, was eine Knospe auf der Verpackung bedeutete. Heute wissen sogar die Kinder, dass dies für Bio steht.
Die Bevölkerung sieht Gentechnik traditionell skeptisch. Früher galt das auch für die Bauern. Wie fühlen Sie sich als Agronom und Sohn einer Bauernfamilie bei dieser Lockerung?
Bei Problemen wie Dürre oder Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel können diese neuen Technologien hilfreich sein. Und wenn Sie mich als Bauernsohn ansprechen: Der Druck, in diesem Bereich schneller voranzukommen, kommt ja vor allem aus der Landwirtschaft. Dass gewisse Pestizide oder Insektizide zum Beispiel aus Gründen des Umwelt- oder Gesundheitsschutzes verboten werden, führt dazu, dass wir Probleme mit der Versorgung bekommen. Ich wüsste nicht, was es uns nützen würde, auf die neuen Züchtungsmethoden zu verzichten, um dann massiv Lebensmittel aus dem Ausland importieren zu müssen.
Biosuisse und die Vereinigung der Kleinbauern sehen das anders als der Bauernverband. Sie haben sogar eine Initiative gestartet.
Diese Initiative fordert weder ein Moratorium noch ein Verbot der neuen Technologien. Ich würde sogar noch weiter gehen: Sie entspricht weitgehend dem Gesetzentwurf, den ich vorgelegt habe. Der Unterschied liegt lediglich in technischen Details. Und die Initiative zeigt, dass selbst einige gentechnik-kritische Kreise offen für Diskussionen sind. Sie wollen lediglich sicherstellen, dass die Risikobewertung ausreichend ist.
Die Samen dieser veränderten Pflanzen würden sich mit dem Pollenflug auch auf anderen Feldern verbreiten. Können Sie uns als Agronom versichern, dass man künftig noch völlig gentechfreie Lebensmittel kaufen kann?
Vielleicht kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass keine Vermischung stattgefunden hat. Aber mit strengen Abstandsregeln können wir sicherstellen, dass dieses Risiko sehr klein bleibt.
Die US-Behörden haben die Schweiz wegen ihres Moratoriums für gentechnisch veränderte Organismen kritisiert. Ist die Liberalisierung auch eine Antwort auf diese Kritik?
Nein, das Parlament hat uns vor drei Jahren beauftragt, an diesem Thema zu arbeiten. Die politische Situation in den USA hat dabei keine Rolle gespielt.
Sie haben im letzten Herbst gesagt, dass Sie eher zu Trump tendieren würden. Haben Sie nun Ihre Meinung geändert, weil seine Regierung plant, umfassende Zölle einzuführen?
Mit meiner Aussage wollte ich vor allem zum Ausdruck bringen, dass ich mich politisch eher der Republikanischen Partei als der Demokratischen Partei zugehörig fühle. Aber für mich ist republikanisch eigentlich gleichbedeutend mit einer Politik, die den Freihandel verteidigt – und nicht mit mehr Zöllen.