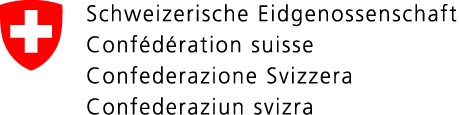Der Kanton Wallis hat im Juni Ja gesagt zum Klimagesetz, jetzt aber die Solaroffensive abgelehnt. Solche Widersprüche sind symptomatisch. Hand aufs Herz, Herr Rösti: Glauben Sie noch an die Energiestrategie?
Im Wallis ist nicht die Solaroffensive abgelehnt worden, sondern die geplante Umsetzung. Offensichtlich hatten viele Leute Angst, dass die Landschaft verbaut werden könnte. Das bedeutet, dass wir vorher Klarheit schaffen müssen: Die Bevölkerung will wissen, wo neue Anlagen realisiert werden und wie gross sie sein dürfen. Genau diese Strategie verfolgen wir mit dem «Mantelerlass», der Ausbauvorlage, die das Parlament Ende Monat hoffentlich verabschiedet: Die Kantone sollen in ihren Richtplänen Gebiete ausscheiden für Solaranlagen und Windkraftwerke. Zudem hat das Parlament die 15 Projekte des Runden Tischs Wasserkraft ins Gesetz aufgenommen. Da werden wir sehen, wie gross die Akzeptanz in der Bevölkerung ist.
Halten Sie es tatsächlich für realistisch, ohne neue Atomkraftwerke (AKW) bis 2050 eine CO2-freie Energieversorgung zu erreichen?
Meine Ambition ist kurzfristiger: Das Allerwichtigste ist, dass wir aus dieser Situation einer drohenden Mangellage im Winter herauskommen. Zurzeit können wir mit Notreserven die grössten Risiken ausschliessen, aber das ist teuer und ökologisch schädlicher, als wir uns das wünschen. Das Notkraftwerk Birr würde pro Tag 24 Eisenbahnwagen Öl verbrennen. Das kann keine dauerhafte Lösung sein. Wir müssen dringend zusätzliche Kapazitäten aufbauen, um nur schon die Versorgung für die nächsten paar Jahre sicherzustellen. Das geht im Moment einzig mit Sonne, Wind und Wasser. Wir haben keine andere Wahl.
Von wie viel Strom reden wir, und woher soll er kommen?
Mein Ziel sind 3 bis 5 Terawattstunden, also etwa 10 Prozent des Gesamtverbrauchs. Dank dem «Windexpress», gegen den es kein Referendum gegeben hat, können wir einige voraussichtlich unbestrittene Windparks schneller bauen. Auch der «Solarexpress» für Anlagen im alpinen Raum ist nicht so erfolglos, wie er gern dargestellt wird: 36 Projekte sind eingereicht, ich erwarte, dass damit 1 bis 2 Terawattstunden realisiert werden können. Bei der Wasserkraft sind vor allem die Projekte Trift, Grimsel und Gornergrat wichtig. Wenn das alles gelingt, wird die Stromversorgung wieder deutlich sicherer sein.
Was ist der Zeithorizont?
(Stöhnt auf.) Bis 2030 oder 2035 dürfte das schon dauern.
Ob Ihr Plan gelingt, ist fraglich. Unter anderem dürfte eines der grössten Projekte – jenes am Gornergrat – von der Stiftung für Landschaftsschutz mit allen Mitteln bekämpft werden. Wie wollen Sie das verhindern?
Die Strategie ist klar: Wir wollen die Kriterien, über die bis anhin in zermürbend langen Verfahren vor Gericht entschieden wird, so weit wie möglich im Gesetz verankern. Das gibt den Investoren mehr Sicherheit. Darüber hinaus appelliere ich an alle, die sich für die Energiewende und den Atomausstieg eingesetzt haben: Genauso wie die Kernkraft negative Auswirkungen hat, war immer klar, dass auch Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke Nachteile mit sich bringen. Ohne sichtbare Eingriffe in die Landschaft geht es nicht. Die nächsten vier, fünf Jahre sind entscheidend. Sie werden zeigen, wie gross der Widerstand ist.
Und wenn er zu gross ist?
Dann wäre die Energiestrategie gescheitert. In diesem Fall werde ich reagieren und aufzeigen, welche anderen Optionen es gibt.
Dann schlagen Sie vor, das Bauverbot für AKW aufzuheben . . .
. . . diese Diskussion ist heute müssig – wenn nicht sogar kontraproduktiv. Ich habe im Moment wirklich gar kein Interesse, eine Debatte über die Kernkraft loszutreten. Meine persönliche Haltung zu diesem Thema ist bekannt, es ist auch kein Geheimnis, dass ich mich als Nationalrat gegen die Energiestrategie eingesetzt habe. Aber das Volk hat sie angenommen. Das gilt es zu akzeptieren. Jetzt müssen wir diesen Weg gehen und im Interesse des Landes versuchen, diese Strategie so gut wie möglich umzusetzen. Es ist nicht meine Aufgabe, Diskussionen über die Kernkraft zu führen. Wir brauchen den zusätzlichen Strom dringend. Es wäre gefährlich, diese Bemühungen mit Grundsatzdiskussionen zu torpedieren. Das würde sofort Druck wegnehmen und den Gegnern von neuen Kraftwerken für erneuerbaren Strom Argumente liefern. Unsere unmittelbaren Probleme lassen sich mit neuen Kernkraftwerken kurzfristig sowieso nicht lösen. Ebenso klar ist aber, dass es keinen zweiten «Fall Mühleberg» geben darf.
Wie meinen Sie das?
Dass die BKW 2019 das Kernkraftwerk Mühleberg einfach so abgeschaltet hat, ist eigentlich unglaublich. Sie hat der Schweiz damit 3 Terawattstunden entzogen – und der Kanton Bern als Eigentümer hat einfach zugeschaut. Das ist nur mit der damaligen Euphorie um den Atomausstieg zu erklären. Dieser Fehlentscheid belastet uns noch heute. Inzwischen ist die Naivität zum Glück verflogen. Bund, Kantone und Konzerne sind sich einig, dass wir die bestehenden Werke so lange betreiben müssen, wie die Sicherheit gewährleistet ist.
Soll der Bund Subventionen bezahlen, um einen längeren Betrieb der AKW zu ermöglichen?
Mit den heutigen hohen Strompreisen ist das kein Thema. Sollte sich das später ändern, stünden vor allem die Kantone in der Pflicht. Es ist kein Zufall, dass sich die Stromproduzenten und somit auch die Kraftwerke in ihrem Besitz befinden. Damit geht eine Verantwortung für die Versorgungssicherheit einher.
Unterstützung für AKW lehnen Sie ab, neue Solaranlagen aber subventioniert der Bund zu 60 Prozent – geht diese Logik auf?
Auch wenn es gegen meine liberalen Prinzipien verstösst, sehe ich zurzeit keine andere Möglichkeit. Die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass wir ohne solche Beiträge keine Investoren für grosse Solaranlagen finden. Und im Moment hat für mich der Zubau Priorität vor ordnungspolitischen Grundsätzen. Ich bin froh, dass wir diese Beiträge ohne zusätzliche Abgaben für die Stromkunden finanzieren können.
Eine Grafik des Bundesamts für Energie zeigt für 2050 eine Energieversorgung ohne Importe. Streben Sie Autarkie an?
Nein, auch nach der Dekarbonisierung sind wir auf Importe, zum Beispiel von Wasserstoff, angewiesen. Wir produzieren schon heute gesamthaft sehr viel Strom. Nur ist die Verteilung über das Jahr ungleich: Im Sommer können wir exportieren, im Winter müssen wir importieren. Das wird sich auch nicht ändern, volle Selbstversorgung für ein Land mitten in Europa ist weder realistisch noch sinnvoll. Der Ausbau unserer eigenen Produktion ist dennoch zwingend – und zwar aus zwei Gründen. Erstens stärkt dies unsere Position als Handelspartner. Wer viel verkaufen kann, kann auch günstiger einkaufen. Zweitens: Wenn der Strom europaweit knapp ist und es hart auf hart kommt, können wir uns nur selber helfen.
Laut der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid gibt es hierzulande keine Versorgungssicherheit ohne Kooperation mit den europäischen Partnern. Wie wichtig ist das Stromabkommen mit der EU, das der Bundesrat abschliessen will?
Es wäre ein Beitrag zugunsten einer sicheren Versorgung, aber keine Garantie für Krisenzeiten. In normalen Zeiten wäre das Abkommen vor allem finanziell wichtig, Swissgrid könnte damit Kosten sparen. Zurzeit wird es immer teurer und schwieriger, die Netzstabilität sicherzustellen, weil die EU uns zunehmend von technischen Kooperationen und Plattformen ausschliesst. Teilweise sind deswegen noch Gerichtsverfahren hängig, aber die EU scheint entschlossen, das durchzuziehen, obwohl es um rein technische Fragen geht.
Die EU will offenkundig den Druck in den laufenden Gesprächen erhöhen. Sie will der Schweiz beim Strom nur entgegenkommen, wenn gleichzeitig die alten Streitfragen von der Rechtsübernahme und der Streitbeilegung bis zum Lohnschutz und zur Zuwanderung gelöst werden. Ihre Partei, die SVP, ist vehement gegen das geplante Verhandlungspaket. Sie aber müssen das Stromabkommen aushandeln. Wie gehen Sie damit um?
Wie bei allen Themen: Zuerst bringe ich meine Position ein, danach trage ich den Entscheid des Bundesrats mit. Wenn der Bundesrat beschliesst, konkrete Verhandlungen über dieses Paket aufzunehmen, sollte der Strom unbedingt Teil davon sein. Aber ich sage klar: Ein Stromabkommen braucht es nicht um jeden Preis. Es wäre zwar hilfreich, aber es ist nicht so, dass der Bundesrat deswegen in wichtigen Fragen seine Position aufgeben und zu grosse Konzessionen machen müsste.
Tatsächlich? Bei Vertretern der Strombranche oder der Industrie tönt das dramatischer: Sie haben Angst wegen der «70-Prozent-Regel». Ab 2025 sollen die EU-Länder 70 Prozent der Netzkapazitäten für den Handel untereinander reservieren. Was würde das bedeuten?
Heute gehen wir nicht davon aus, dass deswegen relevante Probleme drohen. Bis heute bestätigen uns alle Nachbarländer, es sei alternativlos, dass auch die Schweiz in diesen 70 Prozent berücksichtigt werden müsse. Die Schweiz ist physikalisch Teil des europäischen Stromnetzes. Aber leider gibt es keine Sicherheit. Ein Restrisiko bleibt bestehen, dass die EU versuchen wird, die Schweiz in diesem Bereich weiter unter Druck zu setzen. Also müssen wir vorsorgen. Auch aus diesem Grund haben wir kürzlich eine Ausschreibung für neue Notkraftwerke gemacht, was einige sofort kritisiert haben. Wir brauchen das auch als Absicherung gegenüber der EU.
Die EU hofft auf eine Einigung bis Mitte 2024. Doch kürzlich sorgte ein Vertreter aus Ihrem Departement auf der Schweizer Mission in Brüssel für Aufsehen, als er gegenüber SRF sagte, beim Strom sei ein Abschluss frühestens 2025 möglich. Stimmt das?
Der Zeitplan der Gespräche hängt vor allem von anderen Themen ab. Aber die Aussage scheint mir realistisch zu sein. Sicher ist, dass das Abkommen nicht vor 2025 in Kraft treten kann, weil vorher der politische Prozess stattfinden müsste. Deshalb müssen wir uns im Inland wappnen, falls die EU wider Erwarten die 70-Prozent-Regel hart umsetzen und die Schweiz ausschliessen sollte.
Zum Stromabkommen gehört auch die Liberalisierung des Strommarkts für Privathaushalte. Denken Sie, das ist in der Schweiz mehrheitsfähig?
Eine generelle Liberalisierung ist nach den jüngsten Preiserhöhungen unrealistisch. Aber ich gehe davon aus, dass die EU mit einem Wahlmodell einverstanden sein könnte: Wer will, könnte im geschützten Markt bleiben. Daran dürfte das Verhandlungspaket kaum scheitern. In der Schweiz dürfte aber auch das politisch schwierig durchzubringen sein.
Manche Kreise sehen das ganz anders: Sie setzen grosse Hoffnungen in das Stromabkommen und denken, dass das ganze Verhandlungspaket, das immer noch sehr umstritten ist, dank Fortschritten beim Strom eine Mehrheit finden könnte.
Deswegen sage ich sehr deutlich: Die Schweiz braucht nicht um jeden Preis ein Stromabkommen, es wäre aber hilfreich.
Mit anderen Worten: Die Schweiz kann auf ein Stromabkommen verzichten – ist das Ihre Botschaft? Das wäre eine klare Ansage, auch an die EU.
(Überlegt.) Ich sage nur, dass wir uns nicht unbedingt unter Druck setzen lassen sollen. Wir befinden uns in Sondierungsgesprächen mit der EU.
Eben, deshalb könnten Sie hier klipp und klar sagen: Es geht auch ohne Stromabkommen.
Ich kann mich nur wiederholen: Die Schweiz braucht nicht um jeden Preis ein Stromabkommen.
Wie geht es in der Klimapolitik weiter? Das Volk hat im Juni eine Vorlage angenommen, die viele schöne Ziele festlegt, aber kaum Massnahmen. Was nun?
Auch hier gilt: Entscheidend ist die Energieversorgung. Die Klimapolitik leitet sich daraus ab. Um aus Diesel und Öl aussteigen zu können, müssen wir bis 2050 die CO2-freie Stromproduktion massiv ausbauen. Das Parlament ist da inzwischen sehr ehrlich, es strebt einen massiven Ausbau von 45 Terawattstunden an. Das sind 75 Prozent der heutigen Gesamtleistung. Wenn das gelingt – mit welchen Technologien auch immer . . .
. . . wir fragen jetzt nicht noch einmal nach dem Bau neuer AKW . . .
. . . sehr gut. Im Ernst: Die Politik war noch nie in der Lage, dreissig Jahre vorher einen Energiemix festzulegen. Wichtig ist, dass wir das Ausbauziel erreichen, denn damit tragen wir automatisch auch zur Reduktion der Treibhausgase bei. Das ist die einzige Chance. Wenn die Leute sehen, dass eine bezahlbare Stromversorgung garantiert ist, kaufen sie Wärmepumpen oder Elektroautos. Aussichtslos sind hingegen radikale Massnahmen, mit denen gewisse Kreise das Rad zurückdrehen und die Bevölkerung zum Verzicht zwingen wollen. Wir müssen den erarbeiteten Wohlstand bewahren. Die Menschen wollen nicht zurück zur einst angestrebten 2000-Watt-Gesellschaft, sie lassen sich auch das Fliegen nicht verbieten.
Oder das Fleischessen . . .
. . . ja, genau.
Wieso hat dann der Bund soeben ein Strategiepapier veröffentlicht, in dem er leicht tadelnd festhält, die Bevölkerung esse zu viel Fleisch und schade damit sich selbst sowie dem Klima? Auch das Bundesamt für Umwelt aus Ihrem Departement ist daran beteiligt. Ist es Aufgabe des Bundes, unsere Essgewohnheiten zu verändern?
Nein. Der Prozess zur Erarbeitung dieses Papiers hat lange vor meinem Amtsantritt begonnen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass sich die Aussagen zum Essverhalten fast ausschliesslich auf die Ernährungspyramide beschränken, die wir schon in der Schule gelernt haben. Es gibt keinen Zwang, das Papier hat auch keine politische Entscheidrelevanz. Ich versichere Ihnen: Bundesrat Rösti wird keine Ernährungsvorschriften erlassen, solange er nicht dazu gezwungen wird.
Wie setzen Sie die Subventionen aus dem neuen Klimagesetz um?
So pragmatisch wie möglich. Der Schwerpunkt wird auf dem Ersatz von Elektroheizungen liegen, weil wir damit automatisch Strom sparen. In zweiter Priorität erfolgt der Ersatz von Öl- und Gasheizungen, wodurch der CO2-Ausstoss reduziert wird.
Sie mussten das Klimagesetz im Abstimmungskampf gegen die eigene Partei verteidigen. Über Ihren Rollenwechsel vom früheren Parteipräsidenten zum Bundesrat ist viel geschrieben worden. Wie haben Sie ihn erlebt?
Eigentlich gut. Ich bin sehr motiviert. Aber ich will nicht verhehlen, dass der Einstieg mit dieser Abstimmung nicht gerade einfach war. Ich bin und bleibe ein SVP-Mitglied, und das heisst: ein SVP-Bundesrat. Auch wenn ich heute eine andere Rolle habe, werde ich nie vergessen, dass ich dieses Amt nicht zuletzt meiner Partei zu verdanken habe. Gleichzeitig nehme ich die neue Aufgabe sehr ernst: Entscheide des Bundesrats trage ich vollumfänglich mit.
Von aussen entsteht der Eindruck, Ihnen gefalle der Part des differenzierten Bundesrats besser als früher der des polternden Parteichefs.
Dann lasse ich diesen Eindruck doch einfach so stehen.