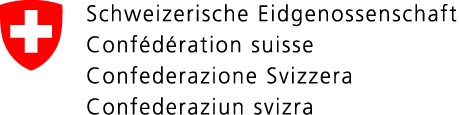- Legislaturplanung (Website der Bundeskanzlei BK)
- Jahresziele des Bundesrats und der Departemente (auch UVEK; Website der Bundeskanzlei BK)
- Leistungsvereinbarungen zwischen dem UVEK und den Bundesämtern
- Strategie des Bundesrats: Nachhaltige Entwicklung (Website des Bundesamts für Raumentwicklung ARE)
- Dossier: Nachhaltige Entwicklung (Website des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE)
- Verkehrsperspektiven Schweiz
- Infrastrukturstrategie des Bundes
- Weitere sektorale Strategien: Themendossiers des UVEK
- Digital Strategie UVEK 2024-2027 - Management Version
Kontakt
Generalsekretariat
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord
CH-3003 Bern
- Tel.
- +41 58 462 55 11