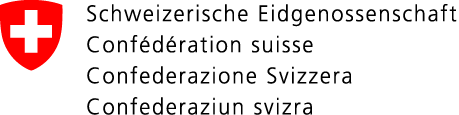Herr Rösti, warum braucht eine Walliser Staumauer Ihren ganz persönlichen Support?
Albert Rösti: Bund, Kantone und Umweltverbände haben sich darauf geeinigt, 16 Wasserkraftwerke zu bauen, die absolut zentral sind für die künftige Energieversorgung der Schweiz. Das Stimmvolk hat diese Projekte bestätigt. Die Hälfte dieser Kraftwerke wird im Wallis stehen. Und die Gornerli-Staumauer bei Zermatt soll mit Abstand den grössten Beitrag leisten. Diese Anstrengung will ich eng begleiten. Darum bin ich ins Wallis gekommen.
Sie sollen mit der Firma Alpiq vereinbart haben, dass diese grosse Staumauer bereits im Sommer 2031 stehen wird. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein?
Ich habe einmal erklärt, hinter den Kulissen, dass dies wünschbar wäre. Ein sehr steiler Fahrplan, das gebe ich zu. Wann das Werk den Betrieb aufnimmt, kann ich heute nicht sagen. Aber es ist in unserem Interesse, dass dies schnell passiert.
Können wir angesichts der Opposition von Umweltverbänden überhaupt noch in einem unberührten Bergtal eine Mauer bauen und einen neuen See stauen?
Die Schweiz muss dazu in der Lage sein. Ein Ausbau der Stromproduktion ist zwingend, wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen wollen. Wir haben ein Netto-Null-Ziel für Treibhausgase beschlossen und ein Stromgesetz verabschiedet, in dem das Projekt am Gornerli explizit erwähnt wird. Kurz- und mittelfristig ist diese Staumauer alternativlos.
Branchenkenner sind der Meinung, dass kaum die Hälfte der 16 Werke gebaut werden wird.
Das macht mir grosse Sorgen. Wir brauchen den Strom nicht in zwanzig Jahren, sondern so schnell wie möglich.
Die Umweltkommission des Ständerats möchte deshalb das Verbandsbeschwerderecht einschränken. Finden Sie das richtig?
Der Bundesrat hat klar gesagt, dass Beschwerden möglich sein sollten. Dabei bleibe ich. Ich rufe die Umweltverbände aber auf, nicht aus Ideologie Projekte zu blockieren. Sonst müssen sie mit einer Reaktion der Politik rechnen, so wie dies der Ständerat gerade tut.
Wird das Beschwerderecht missbraucht?
Das würden die Beschwerdeführer sicher bestreiten. Aber man kann nicht fordern, aus der Kernkraft und den fossilen Energien auszusteigen, und dann beim Ausbau der Erneuerbaren nicht Hand bieten. Das ist schwer nachzuvollziehen.
Zugleich muss man festhalten: Der Solarexpress ist gescheitert, der Zubau an Photovoltaikanlagen in den Alpen wird nie im gewünschten Ausmass passieren. Einverstanden?
Nein, der Solarexpress ist nicht gescheitert. Man hat das Potenzial der Anlagen in den Alpen sicher überschätzt. Aber für mich ist jedes Kilowatt Winterstrom wichtig.
Wäre es da nicht angezeigt, endlich ein Stromabkommen mit der EU abzuschliessen?
Wir sind ja dran. Die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss. Klar gibt es da noch Differenzen, aber es sieht relativ gut aus. Doch auch mit einem Abkommen müssen wir für eine ausreichende Produktion im Inland sorgen.
Ihnen ist als Bundesrat zwei Jahre lang fast alles gelungen. Wie stark schmerzt da eine Ohrfeige wie das Nein zum Autobahnausbau?
Natürlich tut das weh, natürlich bin ich enttäuscht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass mir zuvor immer alles gelang. Der Einstieg in das Amt war gut, das stimmt schon, doch war das ja nicht einfach mein Verdienst. Das gilt auch umgekehrt: Ich habe den Ausbau der Nationalstrassen zwar mit Herzblut vertreten, aber es ist nicht nur Albert Rösti, der diese Abstimmung verloren hat. Jetzt müssen wir das Resultat analysieren und daraus unsere Schlüsse ziehen. Nicht ganz einfach, da die Ablehnung aus recht verschiedenen Gründen zustande kam.
Die da wären?
Links-Grün will eine andere Verkehrspolitik, weniger Geld für die Strasse, das ist klar. Aber auch viele Konservative und Bauern haben Nein gestimmt, obwohl nicht viel Land verlorengegangen wäre. Dazu kommen die wachstumskritischen Stimmen, die sagen, dass ein Ausbau der Infrastruktur nur immer noch mehr Leute anzieht.
Das ist einfach der Versuch der SVP, die Niederlage in Zuwanderungskritik umzudeuten.
Ich führe keine Diskussion über die Zuwanderung. Auch tief konservative Regionen haben diese Vorlage abgelehnt. Dabei könnte ein Argument eine Rolle gespielt haben, das mir noch mehr Sorgen bereitet: Wer von einem Projekt nicht unmittelbar profitiert hätte, sagte Nein. Das war in autofreundlichen Kantonen wie dem Tessin oder in Graubünden der Fall.
Haben die Befürworter gedacht, die Abstimmung gewinne sich praktisch von allein, und die Kampagne auf die leichte Schulter genommen?
Als Bundesrat mache ich keine Kampagne. Aber was mir aufgefallen ist: Die Mehrheit für das Stromgesetz kam auch aufgrund des Engagements der Kantonsregierungen zustande. Bei den Autobahnen war dieser Support sicher nicht im gleichen Ausmass vorhanden.
Der Bundesrat unterstützt einen Vorstoss, der den Ausbau der A 1 zwischen Lausanne und Genf sowie Bern und Zürich auf mindestens sechs Spuren verlangt. Was wird nun damit?
Das können wir jetzt nicht machen. Rein rechtlich ist der Vorstoss zwar noch gültig und der Positionsbezug des Bundesrats ebenfalls. Aber politisch sieht es anders aus. Die Motion ist nach dem vergangenen Sonntag in ihrer absoluten Form nicht mehr umsetzbar. Die Bevölkerung hat die sechs Projekte am Abstimmungssonntag abgelehnt und als Souverän das Parlament übersteuert. Genauso wie sie den Bundesrat übersteuern kann. Das Volk hat in der Schweiz das letzte Wort.
Damit wir uns richtig verstehen: Der durchgehende Ausbau der A 1 auf mindestens sechs Spuren, der ist jetzt vom Tisch?
Ja, der durchgehende Ausbau der A 1 ist aktuell vom Tisch. Das Volk hat jetzt ja zwei Teilstücke auf genau dieser Achse abgelehnt. Damit ist der Gesamtausbau nicht mehr möglich.
Wo wird denn künftig noch ausgebaut?
Nach einer gewissen Enttäuschung sind wir gehalten, wieder nach vorne zu schauen. Die Probleme mit dem Stau sind nicht gelöst. Wir werden jetzt analysieren, wo wir in Zukunft Ausbauten machen wollen. Es braucht jetzt eine Gesamtauslegeordnung auf allen Ebenen und mit allen Parteien und Verkehrsträgern: Autobahnen, Agglomerationsprojekte, aber auch Eisenbahnausbauten.
Die Grünen möchten jetzt Gelder aus dem Nationalstrassenfonds für den Klimaschutz umlenken. Was halten Sie davon?
Das geht gar nicht. Die Gelder, die heute in den Fonds fliessen, werden für Projekte gebraucht, die bereits bewilligt sind. Diese werden auch nicht gestoppt. Der Ausbauschritt, den das Volk abgelehnt hat, wäre ab 2033 realisiert worden. Was dann genau passiert, müssen wir analysieren. Wenn auch bis dahin tatsächlich keine neuen Projekte bewilligt würden, könnten die Abgaben dann reduziert werden.
Geld ist das richtige Stichwort. Wie die NZZ diese Woche bekanntmachte, fehlen für den Ausbau der Schieneninfrastruktur 14 Milliarden Franken. Eine gewaltige Summe.
Die SBB und die Privatbahnen möchten mit dem nächsten grossen Ausbauschritt bis ins Jahr 2035 auf rund sechzig Linien neu den Halbstunden- oder den Viertelstundentakt einführen und 20 Prozent mehr Sitzplätze anbieten. Die Idee der Neigezüge hat nicht funktioniert, manchen Passagieren wurde es übel. Vor allem aber fehlen Reserven, um bei diesem grossen Ausbau einen pünktlichen Betrieb sicherstellen zu können. Das hat zur Folge, dass es zusätzliche Investitionen braucht. So kommt dieser hohe Betrag zustande.
Wie kann es sein, dass plötzlich 14 Milliarden fehlen?
Das Bundesamt für Verkehr hat mich über diese Zahl informiert, der Betrag wurde auf Fachebene ermittelt. Das kann ich bestätigen. Die Zahl betrifft den Zeithorizont der nächsten rund zwanzig Jahre. Die Zahl ist nicht fix und wird jetzt intern und extern überprüft. Ziel muss sein, diesen Betrag zu senken.
Aber das wird man ja nie alles realisieren können, wenn es so viel mehr kostet?
Kommt dazu, dass wir noch weitere Ausbauten realisieren möchten. Zum Beispiel den Durchgangsbahnhof Luzern oder den Bahnhof Basel. Es braucht jetzt aber eine saubere Analyse und eine Gesamtschau, was möglich und prioritär ist. Wie gesagt, wir kennen diese Zahl noch nicht lange, und sie hat alle überrascht.
Wir fahren bald mit der Eisenbahn durch den Neat-Basistunnel Richtung Bern zurück. Wäre die Schweiz, so wie sie heute tickt, noch fähig, ein solches Generationenprojekt zu stemmen?
Es war schon damals nicht einfach. Und heute wäre es noch schwieriger. Mein Kandersteger Vorgänger Dölf Ogi hat das Projekt damals hervorragend verkauft. Aber auch er hatte starken Gegenwind und Streit mit dem Finanzvorsteher. Man muss nicht meinen, heute sei alles schlechter als früher.
Aber?
Ich gebe zu, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Welt ein wenig egoistischer geworden sei. Jeder schaut für sein Gärtli. Ich möchte deshalb zu Zuversicht aufrufen und an das Zusammengehörigkeitsgefühl appellieren. Das würde ich mir schon ein wenig mehr wünschen.
Dieses Land schafft keine grossen Würfe mehr, oder?
Dem möchte und muss ich widersprechen. Ohne Zuversicht kann ein Land nicht in die Zukunft gehen. Wenn ich diese als Infrastrukturminister nicht habe, dann machen wir am Schluss wirklich nichts mehr. Aber das darf nicht passieren. Wir müssen ganz viel bauen in Zukunft! Wir brauchen mehr Stromleitungen, wir brauchen neue Kraftwerke, wir brauchen Kapazitätserweiterungen auf Schienen und Strassen.
Entschuldigen Sie, Sie haben nicht einmal einen moderaten Autobahnausbau zustande gebracht. Wie wollen Sie das alles schaffen?
Ich habe nicht nichts zustande gebracht. Eine Mehrheit der Bevölkerung wollte den Ausbau nicht. Das möchte ich hier schon klarstellen. Ich habe meinen Einsatz geleistet und aufgezeigt, was die Vorteile gewesen wären.
Aber eben. Wie wollen Sie in Zukunft noch Mehrheiten finden für Grossprojekte?
Wenn der Druck gross ist, ist die Bevölkerung in der Regel bereit, die nötigen Massnahmen zu treffen. Das wird auch im Infrastrukturbereich und beim Strom so sein. Davon bin ich überzeugt.
Der Politologe Michael Hermann sagt, dass die Schweiz unter Wachstumsschmerzen leide. Spüren Sie den Schmerz auch?
Natürlich sehe ich solche Tendenzen. Das Bevölkerungswachstum geht nicht spurlos am Land und an der Bevölkerung vorbei. Das ist so. Deshalb wird die Frage der Zuwanderung weiterhin ein politisches Schwerpunktthema bleiben.
Sind Sie für eine Schweiz, die nicht mehr als 10 Millionen Einwohner hat? Diese Schwelle will Ihre Partei in die Verfassung schreiben.
Der Bundesrat lehnt diese Initiative ab, weil wir die Personenfreizügigkeit künden müssten. Das hätte gemäss Bundesrat einen negativen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Fachkräften. Aber man muss sicher die Bedürfnisse und die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen. Deshalb hat der Bundesrat auch beschlossen, ein Begleitpaket zu machen, das die negativen Folgen der Zuwanderung abfedern soll.
Sind 10 Millionen Einwohner denn für Sie etwas, das Ihnen Angst macht?
Ich habe schon zwei Seelen in meiner Brust. Ich möchte den Menschen eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das ist mein klarer Auftrag. Auf der anderen Seite möchte ich den Schutz von Natur und Umwelt sicherstellen. Ich möchte schon, dass die Schweiz die Schweiz bleibt.
Kann die Schweiz die Schweiz bleiben, wenn sie weiter so stark wächst?
Es ist absehbar, dass die Schweiz diese Zahl bald erreichen wird. Es muss uns gelingen, in den Städten und in den Agglomerationen zu verdichten. Wir dürfen nicht mehr so stark in die Fläche bauen und so viel Land verbrauchen. Dazu ist die Bevölkerung nicht bereit. Das hat sich am Sonntag auch gezeigt.
Herr Rösti, haben Sie jetzt den Zug genommen, weil Sie der gescheiterte Autobahnausbau derart nervt?
Sicher nicht. Ich nehme das Verkehrsmittel, das mich am schnellsten von A nach B bringt. Wenn man von Bern ins Wallis will, dann ist das der schnellste Weg. Und ich kann in der Eisenbahn unter meinem wunderbaren Geburtsort Kandersteg durchfahren.